Kritischer Rationalismus
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie im Diskurs
Esther Seyffarth, Linda Schaffarczyk
27.01.2016
Themenüberblick
- Karl Popper
- Kritischer Rationalismus im Überblick
- Induktion und Deduktion
- Abgrenzungsproblem
- Falsifizierbarkeit
- Kausalität
- Objektivität und Subjektivität
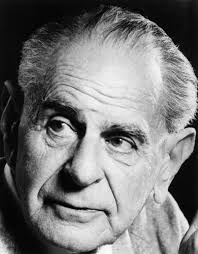
Karl Popper
Karl Popper
- * 28. Juli 1902 (in Wien)
- † 17. September 1994
- schloss 1924 Tischerlehre mit Gesellenbrief ab
- Kontakt mit Wiener Kreis, war jedoch kein Mitglied
- lehrte von 1930 - 1935 als Hauptschullehrer
- heiratete 1930 seine Kollegin Josefine Anna Henninger
- 1965 von Königin Elisabeth II zum "knight Bachelor" geschlagen (Sir Karl Popper)
- Veröffentlichte 1934 das Buch Logik der Forschung in dem er seine Wissensschaftstheorie umfassend darlegte
- Studium 1920er Jahre (Doktor in Philosophie)
Kritischer Rationalismus (1/2)
- Eine nichtinduktionslogische Erkenntnistheorie, entwickelt vor allem von Karl Popper in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Streng logische, dogmenfreie Herangehensweise an wissenschaftliche Fragestellungen
- Durch die Ablehnung der Induktion ist die Verifikation von Aussagen unmöglich; Aussagen können nur falsifiziert werden!
Kritischer Rationalismus (2/2)
- Falsifikation ermöglicht das Finden der "haltbarsten" Erklärung für Phänomene
- Klare Trennung zwischen Erkenntnispsychologie und Erkenntnislogik: Subjektive Erlebnisse werden als nicht empirisch-wissenschaftlich angesehen
Induktion und Deduktion (1/2)
- Empirische Wissenschaften folgen (unberechtigt?) der induktiven Methode (Schluss von besonderen Sätzen auf allgemeine Sätze)
- Induktionsproblem: Frage, ob und wann induktive Schlüsse berechtigt sind
- Typisches Beispiel: "Alle Schwäne sind weiß."
- Notwendig: Ein Induktionsprinzip, das ermöglicht, induktive Schlüsse logisch zulänglich zu machen
Induktion und Deduktion (2/2)
- Der Kritische Rationalismus lehnt ein solches Induktionsprinzip ab: Das Induktionsprinzip kann kein allgemeiner Satz sein, weil allgemeine Sätze nicht induktiv gerechtfertigt sind usw.
- Auch Wahrscheinlichkeitsschlüsse werden abgelehnt
- Wissenschaftliche Theorien werden nicht durch Induktion aus Beobachtungen gewonnen; sie sind das Ergebnis eines kreativen Denkprozesses z.B. durch Intuition oder Versuch und Irrtum
Induktion und Deduktion (1/2)
- Poppers Auffassung: "Lehre von der deduktiven Methodik der Nachprüfung"
- Trennung zwischen Erkenntnispsychologie und Erkenntnislogik: Das Aufstellen von Theorien fällt in den Bereich der Psychologie, das Überprüfen in den Bereich der Logik
- "schöpferische Intuition" ist nicht logisch
- Vorgang der Deduktion: Aus einer Hypothese werden logisch Folgerungen abgeleitet, die verglichen und bezüglich ihrer logischen Beziehungen analysiert werden
Induktion und Deduktion (2/2)
- Praktische Gültigkeit der Folgerungen wird durch die empirische Anwendung geprüft, z.B. in Experimenten oder technischer Umsetzung von Ideen
- Wichtig: leicht nachprüfbare, anwendbare, singuläre Folgerungen
- Im Erfolgsfall wird das System nicht verworfen, bei negativen Ergebnissen einzelner Prüfungen wird das gesamte System falsifiziert
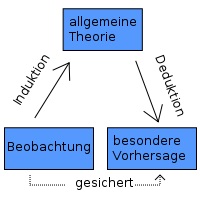
Abgrenzungsproblem (1/2)
- Gesucht: Ein Kriterium, durch das die empirische Wissenschaft von Mathematik und Logik, aber auch von "metaphysischen" System abgegrenzt werden kann
- Bezug auf Hume, Kant, Wittgenstein
- Induktionsmethode laut Popper nicht geeignet
- Metaphysik: nicht empirisch-wissenschaftlich
Abgrenzungsproblem (2/2)
- Naturgesetze sind nicht logisch auf elementare Erfahrungssätze zurückführbar und würden somit nach Wittgenstein auch als Metaphysik eingeordnet und abgelehnt werden
- Poppers Antwort: Klare Definitionen von Metaphysik und Wissenschaft - letztendlich eine intuitive, nicht logische Entscheidung
Wahrheitsnahe Theorien
- Theorien lassen sich nicht auf ihre Wahrsheitsnähe untersuchen, man kann jedoch Theorien vergleichen und feststellen, dass eine Theorie wahrheitsnäher ist als eine andere
- Überprüfen einer Theorie ist immer doppelt relativ:
- relativ zum Stand des derzeitiges Beobachtungswissens
- relativ zum Stand der derzeitigen Alternativtheorien
Falsifizierbarkeit
- Verbreitete Ansicht: empirisch-wissenschaftliche Sätze müssen endgültig entscheidbar sein, sowohl ihre Verifikation als auch ihre Falsifikation muss logisch möglich sein
- Popper: Verifikation von Aussagen ist logisch unzulässig!
Die logische Form des Systems soll ermöglichen, dieses auf dem Wege der methodischen Nachprüfung negativ auszuzeichnen: Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können.
Kausalität
- Kausale Erklärung eines Vorgangs: einen Satz, der den Vorgang beschreibt, deduktiv aus Gesetzen und Randbedingungen ableiten
- Zusammenwirken von Hypothesen (allgemeinen Sätzen) und Beobachtungen (besondere Sätze)
- Kausalsätze behaupten, dass jeder beliebige Vorgang kausal erklärt, also prognostiziert, werden kann
- Popper nennt solche Sätze metaphysisch und lehnt die daraus entstehenden Tautologien ab
Objektivität und Subjektivität
- Bei Kant: wissenschaftliche Erkenntnisse sind objektiv, wenn ihre Begründungen von jedem Menschen nachgeprüft und eingesehen werden können
- Popper: Objektivität = Intersubjektive Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit
- Subjektive Überzeugungen werden klar von wissenschaftlichen Begründungen abgegrenzt
- Besonderheit bei Popper: Keine Verifizierung nötig, sondern nur Nachprüfbarkeit
Prüfbarkeit
Jeder empirisch-wissenschaftliche Satz muss durch Angabe der Versuchsanordnung u. dgl. in einer Form vorgelegt werden, dass jeder, der die Technik des betreffenden Gebietes beherrscht, imstande ist, ihn nachzuprüfen.
- Bei Zweifeln muss eine Gegenbehauptung mit neuen Prüfungsanweisungen aufgestellt werden
- Der empirische Gehalt einer Theorie wächst mit ihrem Falsifizierbarkeitsgrad
Kritischer Rationalismus auf einen Blick
- Induktion wird abgelehnt
- Deduktion und Falsifizierbarkeit sind zusammen eine gute wissenschaftliche Grundlage
- Intersubjektivität und Nachprüfbarkeit ermöglichen es, die Gültigkeit von Sätzen zu bewerten
- Klare Trennung von psychologischen und logischen Schlüssen
Kritischer Rationalismus und Informationswissenschaft
- Empirische Informationswissenschaft
- Umfragen, Studien etc.
- Subjektive Wahrnehmung (z.B. Relevanz)
- Problem: Oft Induktion oder subjektive Themen
Kritischer Rationalismus und Computerlinguistik
- Unfalsifizierbare Theorien
- Universal Grammar
- Grammatikalitätsurteile
- Falsifizierbare Theorien
- Korpuslinguistisch untersuchbare Phänomene
- Formale Sprachen und Abgeschlossenheitsbedingungen
Diskussion
- Ist es gerechtfertigt, auch Wahrscheinlichkeitsschlüsse abzulehnen?
- Was ist der Wert einer Theorie, die nie endgültig wahr sein kann, sondern sich nur vorläufig bewährt, bis sie sich als falsch erweist?
- Ist Objektivität wirklich das gleiche wie Intersubjektivität?
- Wird in den Veröffentlichungen der InfoWiss/Linguistik auf die nachprüfbare Darstellung von Deduktionsketten und auf die Reproduzierbarkeit von Studien/Experimenten geachtet?
Quellen
- Popper, Karl: Logik der Forschung (1935)
- Popper, Karl: Science as Falsification (1963)
- Leschke, Martin: Karl Poppers kritischer Rationalismus (1999)
- Schurz, Gerhard: Das Problem der Induktion (1994)
- http://plato.stanford.edu/entries/popper/
- http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/217241,0.html
- http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kritischer-rationalismus/4423